VO Medienökonomie
hallo.
also, paar fragen sind beantwortet, manche eben noch nicht. ;-)
vielleicht kann jemand die bestehenden lücken schließen, oder etwaige fehlerhaft beantwortete fragen richtig stellen - am besten über die kommentar funktion.
oder schreibt ein email an: guenter.baumgartner@sbg.ac.at - ich werd die antworten jeweils aktualisieren.
zum runterladen auf http://www.yahman.de!
danke für die zusammenarbeit.
grüße guda
----------------------------------------------------------------------------
1. Charakterisieren Sie die verschiedenen Kapital-Typen in der (erweiterten) Medienindustrie und deren Bedeutung für den Strukturwandel der Medienindustrie!
- Nach dem Kriterium des schwerpunktmäßigen Einsatzes der jeweiligen Kapitale in der Medienindustrie unterscheidet man 4 Kapital-Typen:
o Medienkapital: wird in der Produktion und Distribution der klassischen Mediensektoren verwertet (Presse, Buch, Hörfunk, Film, Fernsehen…)
o Medienbezogenes Kapital: Kapital für die technische Herstellung und Distribution von Medienproduktion sowie Produktion von Medientechnik (Papier-, Druck- und Maschinenbauindustrie, Post…)
o Medieninfrastrukturkapital: Kapital der Übertragungs- und Vermittlungstechnik und der Telekommunikationsdienste (Kabel-, Satelliten-, Telefonindustrie, Computerindustrie…)
o Medienfremdes Kapital: Kapital aus allen Wirtschaftszweigen (Banken, Handels-, Bau- und Verkehrsunternehmen)
- Kennzeichnend für den aktuellen Strukturwandel der Medienindustrie ist, es, dass nicht nur traditionelles Medienkapital, sondern auch zunehmend Kapital aus verschiedenen anderen Wirtschaftsbereichen aktiv ist, so dass man mit Recht von einer erweiterten Medienwirtschaft sprechen kann.
2. Welche Ebenen kann man bei der staatlichen Privatisierungspolitik allgemein unterscheiden? Inwiefern ist eine umfassende Privatisierungspolitik Kennzeichen eines grundlegenden Strukturwandels des Kapitalismus?
1.Drei Ebenen der staatlichen Privatisierung:
a) Staatskapitalprivatisierung = Überführung von Unternehmen, die bislang vollständig oder teilweise im Staatseigentum waren, in Privateigentum
b) Aufgabenprivatisierung = schrittweise Privatisierung öffentlicher Unternehmen aus dem Bereich der Infrastruktur, die bislang aufgrund der sozialen Bedeutung ihrer angebotenen öffentlichen Güter, als Träger öffentlicher Aufgaben fungierten.
c) Staatsprivatisierung = (Teil-)Privatisierung von klassischen Staatsfunktionen (z.B: privatwirtschaftliche Sicherheitsdienste, Universitäten) und Unterwerfung staatlicher Einrichtungen unter die Normen privatwirtschaftlicher Unternehmensprinzipien (öffentliche Verwaltungen, Universitäten).
2. Privatisierungspolitik als Kennzeichen für Strukturwandel des Kapitalismus:
Die Privatisierungspolitik des Staates ist ein Kennzeichen des Strukturwandels des Kapitalismus, da bislang, die vor allem in Westeuropa noch bestehenden mixed economics (= staatliches Eigentum an Produktionsmitteln als Korrektiv (= Mittel zum Ausgleich) zum privatwirtschaftlichen Eigentum an Produktionsmitteln) radikal in eine fast ausschließlich privatwirtschaftliche Ökonomie umgewandelt werden.
3. Welche Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie lassen sich benennen, die im Zusammenhang mit der „Entfesselung“ bzw. Transformation des Kapitalismus bzw. der Medienindustrie stehen?
- Die marktradikal „entfesselte“ Medienindustrie hängt mit dem ebenfalls „entfesselten“ globalen Transformationsprozess des Kapitalismus zusammen, der u.a. schlagwortartig als „Turbo Kapitalismus“ oder als „Shareholder-Society“ oder als „Kapitalismus pur“ gekennzeichnet wird.
- Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie sind folgende grundsätzliche für die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnende Faktoren:
o Das rechtlich geschützte Privateigentum an Produktionsmittel sowie die daraus abgeleitete Verfügungsmacht über die abhängig Arbeitenden sowie das Recht der alleinigen Bestimmung der Produktionsziele und der Verwertung der produzierten Waren durch das Kapital.
o Die Form kapitalistischer Produktionsverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse von Kapital über Arbeit
o Der widersprüchliche Zusammenhang von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
o Die kapitalistische Warenproduktion als Produktion von Werten (Gebrauchs- und Tauschwerte). Die Tauschwertrealisierung für die Kapitaleigner dominiert dabei die Gebrauchswertinteressen der Konsumenten.
o Die kapitalistische Mehrwertproduktion
o Der Zusammenhang von Produktions-, Verwertungs- und Profitzwang mit Konkurrenz, Akkumulation, Konzentration und Zentralisation des Kapitals
o Die kapitalistische Herrschaftssicherung durch das Zusammenwirken von Kapitaleignern und Staat
o Die Kapitalisierung der Gesellschaft
4. Welche „Ideologischen Mächte“ betreiben in welcher Weise die Ideologie- Produktion und -Distribution in der Gesellschaft? Welche Rolle spielen dabei die Massenmedien?
Die ideologischen Mächte sind/ ist der Staat (Regierung, Verwaltung, Polizei und Militär)
Sie betreiben ihre Ideologieproduktion und –distribution in dem sie ihre Vertreter (zB. Schulen, öffentlicher Dienst,…) mit Geld versorgen, denn damit müssen sich Vertreter nach den Interessen ihrer Kapitalgeber richten und orientieren. Diese Vertreter üben dann eine Art Zwang auf den einfachen Bürger aus, denn er will ja schließlich die „Produkte“ zB. Bildung, Sicherheit, Kleidung, Auto,… haben – weil ihm dies ja mittels der Massenmedien vermittelt wird, was man haben muss, braucht und so weiter also Ideologiedistribution wird mittels den Massenmedien betrieben.
5. Beschreiben und erläutern Sie verschiedene Formen von Kapitalisierungsschüben/Kapitalisierung der Medienindustrie!
Als Formen des Kapitalisierungsschubs in der Medienindustrie kann man folgende nennen:
o Produktversifikationen und –innovationen
o Die Privatisierung von Hörfunk, Fernsehen, Tele- und Mobilkommunikation sowie dem Internet
o Die Digitalisierung
o Neue Werbeformen /Merchandising
o Börsengänge und Kapitalbeschaffungen
o Aktiengesellschaft
Privatisierung: durch die Privatisierung kommt mehr Geld in die gesamte Medienindustrie
Kommerzialisierung: es werden zusätzliche Absatzmöglichkeiten geschaffen, es werden quasi neue Sachen geschaffen, die die Menschheit haben will
Erweiterung der Medienindustrie: durch zB. neue Werbeformen und Merchandising werden mehr Konsumenten erreicht bzw. man setzt mehr ab
Produktdiversifikation und –innovation: „alte Produkte“ werden variiert, verändert und als „neue Produkte“ auf den Markt gebracht. Es werden einfach mehr verschiedene Arten eines Produkts angeboten.
6. Beschreiben und erläutern Sie die hauptsächlichen Kapitalstrategien, die den Strukturwandel der Medienindustrie vorantreiben!
Vorrangig sind es 4 strategische Ziele:
>Ersatz von „alter“ durch „neue“ Medientechnik: von langfristigen Gebrauchsgütern zu kurzfristigen Verbrauchsgütern ( zb. Fernsehen – Schwarz-Weiß Fernseher, dann Farbfernseher, Stereofernsehgerät,…)
>Neue Übertragungswege für „alte“ Medienprodukte: also von analog auf digital (zb.: Modem – ISDN – DSL)
>Neue Eigentumsrechte für Mediensektoren und Netze
>Reduzierung von Produktions- und Transaktionskosten: geht in Richtung „Universalmedium“
7. Was bedeutet „Kapitalisierung“ der Medienindustrie? Welche wesentlichen Kennzeichen eines „Kapitalisierungsschubs“ in der Medienindustrie sind erkennbar?
- Darunter versteht man eine angesichts des unübersehbaren Strukturwandels einer durch Deregulierung, Privatisierung, Digitalisierung, Konzentration, Globalisierung etc. „entfesselte Medienindustrie“. Es geht also um eine weitere historische Phase der fortschreitenden Kapitalisierung der privatwirtschaftlichen Medienindustrie, d.h. um eine radikale Unterordnung des gesamten Mediensystems unter die allgemeinen Kapitalverwertungsbedingungen. Die Medienindustrie ist damit auch intensiver als bisher den Bewegungsgesetzen und Zwängen von Produktion und Kapitalverwertung, von Profitmaximierung und Konkurrenz sowie von Akkumulation und Konzentration unterworfen.
- Kennzeichen des Kapitalisierungsschubs in der Medienindustrie sind:
o Eine Kapitalisierung über Privatisierung, Deregulierung, Kommerzialisierung von zusätzlichen Sektoren der Medienindustrie, die bislang staatlich oder ö.r. waren
o Ein Strukturwandel, der sich in Kommerzialisierung der Medieninhalte-Produktion, in internationaler publizistischer und ökonomischer Konzentration und in Verflechtungen traditioneller und neuer Sektoren zeigt
o Kapitalisierung des Verhältnisses von Staat und Medienwirtschaft, sowie der staatlichen Medienpolitik als Medienwirtschaftspolitik
o Kapitalisierung der ökonomischen und politischen Funktionserfüllung der Medienindustrie)
8. Wie ist Ideologie im Rahmen von wissenschaftlicher Ideologiekritik definiert? Was impliziert diese Definition und was n i c h t ? Welcher Zusammenhang besteht mit Herrschaft und wie ist diese definiert?
Definition von Ideologie:
Gedankliches/emotionales Gerüst und praktisch wirksames Konstrukt von Sinnstiftung, Normsetzung und Legitimation/Verschleierung von Herrschaft
- zur Stabilisierung und Reproduktion von Herrschaft
- komplementär zu repressiven Mitteln der zwangsweisen Durchsetzung von Herrschaft
diese impliziert…
- Trennung von Wissenschaft und Ideologie
- Wahrheit/Wirklichkeit vs. Ideologie
Diese impliziert nicht…
- Ideologie im Sinne von „Weltanschauung“
- Im Sinne eines „wissenschaftlichen Marxismus als Ideologie“
- Im Sinne der Wissenssoziologie als „geistige Gebilde“
Zusammenhang mit Herrschaft:
- zwangsweise Durchsetzung von Herrschaft durch Ideologieproduktion
- Stabilisierung und Reproduktion von Herrschaft
Herrschaft:
- umfassende ökonomische/politische/kulturelle/gesellschaftliche Verfügungsmacht
- einer gesellschaftlichen Klasse/Schicht/Gruppe
- über eine oder mehrere andere Klasse(n)/Schicht(en)/Gruppe(n) (Arbeits- und Lebensverhältnisse)
9. Worin zeigte sich in der Geschichte der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft eine „Angst vor Marx“ und eine „Angst, als Marxist zu gelten“? Wie berechtigt ist die eine und die andere Angst?
- Die Analysen von Karl Marx werden in der Regel verschwiegen oder marginalisiert, wenn sie thematisiert werden, so am ehesten negativ. Es kam zur weltweit eindeutigen Dominanz der neuklassischen Sicht. Wer Marx’sche Theorien adaptierte, wurde als (gefährlicher) Marxist, Kommunist, Systemgegner… abgestempelt und in seinen Möglichkeiten der Berufstätigkeit in Wissenschaft, Massenmedien usw. erheblich Berufsverbote).
- Daher unberechtigte Angst vor Marx, aber berechtigte Angst als Marxist zu gelten
10. Welche Stadien der Entwicklung von staatlicher De- und Re- Regulierungspolitik und „Selbstregulierung“ des Kapitals lassen sich im Strukturwandel der Medienindustrie erkennen? Welches Stadium ist das dominante?
- 3 sich zeitlich überlappende Stadien der Entwicklung:
o Deregulierung von Seiten des Staates durch Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen für die Privatisierung staatlicher oder ö.r. Unternehmen
o Selbstregulierung der Industrien hauptsächlich durch Großkapitale mit Hilfe eines wettbewerbsbeschränkenden Marktverhaltens mit dem Ziel der Marktbeherrschung.
o (Re-)Regulierung von Seiten des Staates, ebenfalls durch Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen, mit dem Ziel, die Verwertungsbedingungen des marktbeherrschenden Kapitals durch eine „Marktordnung“ und gezielte Förderungsmaßnahmen risikomindernd mittel- bis langfristig abzusichern und „Legitimierungen“ zu schaffen.
11. Benennen Sie verschiedene Folgen der Kapitalisierung der Medienindustrie, die bedeutsam sind!
- Als allgemeinste Folge der weiteren Kapitalisierung der Medienindustrie ist zu beobachten, dass die Medienindustrie noch stärker als bisher dem allgemeinen und medienspezifischen Struktur- und Funktionswandel von Wirtschaft und Gesellschaft gemäß den Kapitalverwertungsinteressen unterzogen wird und diesen gleichzeitig mit beeinflusst. Die Folgen der damit einhergehenden Ausweitung der Kommerzialisierung der Medienproduktion erstrecken sich insbesondere auf:
o Die Gestaltung der Medienprodukte als Konsumgüter
o Den Ausbau der Funktion der Medien als Werbe- bzw. Warenzirkulationsmittel für die Volkswirtschaft
o Die Verstärkung internationaler Kapital- und Marktkonzentration
o Die Ausbreitung struktureller Arbeitslosigkeit in der Medienindustrie
o Die Regeneration der Arbeitskräfte gemäß Kapitalinteressen
o Die Beeinflussung der Bevölkerung im Hinblick auf Absatzförderung
o Die weitere Ausrichtung staatlicher Medienpolitik an den Kapitalinteressen
o Die Legitimation und Herrschaftssicherung des internationalen kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems
12. Beschreiben Sie Ansätze zu ökonomischen Regulierungstheorien mit
ihrer jeweiligen Sichtweise der Rolle des Staates gegenüber dem Kapital!
- In der Sichtweise der normativen neoklassischen bzw. neoliberalen Theorie, in der Regulierung als systemwidriger Staatseingriff in die individuelle Handlungsfreiheit des Kapitals grundsätzlich als negativ und nur im Ausnahmefall des Marktversagens als notwendig angesehen wird, soll sich der Staat mit Regulierungsmaßnahmen zurückhalten.
- In der einfachen Capture-Theorie der Chicagoer Schule wird staatliche Regulierung als „ein Mittel zur Durchsetzung der Interessen der Regulierten“ angesehen.
- In der erweiterten Capture-Theorie werden vom Staat als Regulator auch Konsumenteninteressen berücksichtigt, soweit es als politisch angebracht erscheint.
- In der Sichtweise des Neuen Institutionalismus in Verbindungen mit dem Transaktionskostenansatz geht man davon aus, dass Regulierung durchaus kostengünstig und effizient und deshalb für das Kapital nützlich bis notwendig sein können; Regulierungen sind jedoch nicht auf staatliche Aktivitäten beschränkt, sondern auch über Verträge zwischen Firmen möglich.
- In der Keynesianischen Theorie wird staatliche Regulierung grundsätzlich als notwendig angesehen, um langfristig sinnvolles Investitionsverhalten von Unternehmen zu ermöglichen und damit die Stabilität der gesamten Wirtschaft zu sichern.
- In der marxistischen Theorie des Staatsmonopolistischen Kapitalismus gilt die staatliche Regulierung im Interesse und im Zusammenwirken mit privatwirtschaftlichen Monopolen als ein wesentliches Strukturmerkmal des kapitalistischen Wirtschaftssystems und damit als eine notwendige zentrale Steuerungsinstanz
- In der (französischen) Regulationstheorie, die beansprucht, mehr als eine nur ökonomische Theorie zur Funktionsweise des Kapitalismus zu sein, wird dem Staat ein zentraler Stellenwert im System verschiedener regulativer Institutionen zugeschrieben. Allerdings wird von Kritikern eingewandt, dass es an einer näheren Bestimmung der Rolle des Staates bislang mangele.
13. Beschreiben und erläutern Sie Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie!
Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie sind folgende grundsätzliche für die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnende Faktoren:
o Das rechtlich geschützte Privateigentum an Produktionsmittel sowie die daraus abgeleitete Verfügungsmacht über die abhängig Arbeitenden sowie das Recht der alleinigen Bestimmung der Produktionsziele und der Verwertung der produzierten Waren durch das Kapital.
o Die Form kapitalistischer Produktionsverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse von Kapital über Arbeit
o Der widersprüchliche Zusammenhang von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
o Die kapitalistische Warenproduktion als Produktion von Werten (Gebrauchs- und Tauschwerte). Die Tauschwertrealisierung für die Kapitaleigner dominiert dabei die Gebrauchswertinteressen der Konsumenten.
o Die kapitalistische Mehrwertproduktion
o Der Zusammenhang von Produktions-, Verwertungs- und Profitzwang mit Konkurrenz, Akkumulation, Konzentration und Zentralisation des Kapitals
o Die kapitalistische Herrschaftssicherung durch das Zusammenwirken von Kapitaleignern und Staat
o Die Kapitalisierung der Gesellschaft
14. Wie wahrscheinlich ist eine „Universalisierung“ des Mediensystems? Welche unterschiedlichen Interessenlagen sind voraussichtlich in welchem Ausmaß bestimmend dafür, wie die bestehenden Separierungen von Medienproduktion, -distribution und -konsumtion in Richtung (partieller) „Universalisierung“ verändert werden?
- Traditionelle Produktion, Distribution und Konsumtion von Medien vs. Universalmedium:
o Produktion: Wegfall von Unternehmensbereichen für Produktion von begrenzten Kommunikationsformen, wie nur Text-/Bildkommunikation (Presse- und Buchverlag) oder nur Tonkommunikation (Musikverlage)
o Speicherung/Reproduktion: Wegfall von Unternehmensbereichen für die Herstellung jeglicher Trägemedien
o Distribution/Übertragung: Wegfall von Unternehmensbereichen für den Vertrieb weiterer Trägermedien und die Herstellung von gesonderten Netzen.
o Konsumption: Wegfall von Unternehmen für die Herstellung von gesonderten Empfangsgeräten für Ton- und AV-Medien.
Marktbeherrschenden Medienunternehmen, die Ausmaß, Reihenfolge und Tempo der Universalisierung bestimmen und potentielle Nutznießer einer Universalisierung wären, sind nur teilweise daran interessiert, da ihnen zum einen eine komplementäre Produktion, Distribution und Konsumtion mehr dient als eine substitutive und zum anderen in diesem Fall die Mehrfachverwertung wegfallen würde, die für die Kapitalverwertung existenznotwendig ist. D.h. eine Separierung in verschiedene Mediensektoren und Übertragungswege ist derzeit noch ökonomisch gewollt und genutzt.
15. Was bedeutet „Kapitalisierung“ der Medienindustrie? Welche wesentlichen Kennzeichen eines „Kapitalisierungsschubs“ in der Medienindustrie sind erkennbar?
- Darunter versteht man eine angesichts des unübersehbaren Strukturwandels einer durch Deregulierung, Privatisierung, Digitalisierung, Konzentration, Globalisierung etc. „entfesselte Medienindustrie“. Es geht also um eine weitere historische Phase der fortschreitenden Kapitalisierung der privatwirtschaftlichen Medienindustrie, d.h. um eine radikale Unterordnung des gesamten Mediensystems unter die allgemeinen Kapitalverwertungsbedingungen. Die Medienindustrie ist damit auch intensiver als bisher den Bewegungsgesetzen und Zwängen von Produktion und Kapitalverwertung, von Profitmaximierung und Konkurrenz sowie von Akkumulation und Konzentration unterworfen.
- Kennzeichen des Kapitalisierungsschubs in der Medienindustrie sind:
o Eine Kapitalisierung über Privatisierung, Deregulierung, Kommerzialisierung von zusätzlichen Sektoren der Medienindustrie, die bislang staatlich oder ö.r. waren
o Ein Strukturwandel, der sich in Kommerzialisierung der Medieninhalte-Produktion, in internationaler publizistischer und ökonomischer Konzentration und in Verflechtungen traditioneller und neuer Sektoren zeigt
o Kapitalisierung des Verhältnisses von Staat und Medienwirtschaft, sowie der staatlichen Medienpolitik als Medienwirtschaftspolitik
o Kapitalisierung der ökonomischen und politischen Funktionserfüllung der Medienindustrie)
16. Beschreiben und erläutern Sie die „Kettenreaktionen“ von Investition und Produkt-„Innovation“ im Kapitalakkumulationsprozess!
Es besteht ein Zusammenhang von Medientechniken mit Investitions-, Produktions-, Distributions-, und Konsumtionsmitteln. Daraus ergeben sich Investitions-/ Produktions- und Innovations- Zwänge. Diese lösen bestimmte Kettenreaktionen von Investition und Produkt- Innovation im Kapitalakkumulationsprozess aus.
Treibende Kräfte:
- das durch Profitmaximierung angehäufte Kapital, dessen Entwertung durch Überakkumulation, Überkapazität und Überproduktion droht
- Gefahr der gesättigten Märkte
Im Zusammenhang damit spielt die Entwicklung und der Einsatz alter und neuer Medientechniken eine zentrale Rolle.
Der Ersatz von alter durch neue Medientechnik dient drei Zielen:
- langlebige Gebrauchswaren zu möglichst kurzlebigen Gebrauchswaren
- langlebige Gebrauchswaren zu möglichst kurzlebigen Verbrauchwaren
- Erweiterung der Produktion und des Verkaufs von kurzlebigen Verbrauchswaren (z.B.: Wegwerfkamera).
Innovations- /Obsoleszenz (= Abnutzung) – Strategien:
- geplante funktionell- technische O. als reale Funktionsveränderung /-erweiterung hinsichtlich des Zusatzgebrauchwert eines Produkts
- geplante qualitative O. als reale Gebrauchswertverschlechterung (frühzeitiger Verschleiß)
- geplante psychische/ ästhetische O. als ästhetische Innovation/Veralterung als bewusstseinsmässige Gebrauchswertentwertung (unmodern machen)
17. Welche ökonomischen und gesellschaftlichen Funktionen der Medienproduktion stehen im Mittelpunkt einer Kritik der politischen Ökonomie der Medien?
- Grundlegend sind vier Hauptfunktionen der Medienproduktion, 2 ökonomische und 2 gesellschaftliche:
o Kapitalverwertungsfunktion: Medienprodukte werden als Waren mit Gebrauchswert produziert, um einen Tauschwert zu ermöglichen, welcher den Medien-Kapitaleignern einen Mehrwert bringt
o Absatzförderungsfunktion: Medienprodukte müssen einen Gebrauchswert haben, um einen Tauschwert für Konsumgüter als Waren zu fördern
o Funktion der Legitimations- und Herrschaftssicherung: Medienkapital erfüllt systemsichernde Gattungsgeschäfte
o Funktionen der Regeneration, Qualifizierung und „Reparatur“ des Arbeitsvermögens: Mittels der Medienprodukte wird im Interesse der Kapitaleigner und des mit ihnen eng kooperierenden Staates ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Reproduktion der Arbeitskräfte geleistet
18. Nennen Sie einige legitimatorische und geldwerte Leistungen des Staates für das Medienkapital! Inwiefern ist hierbei der Staat als „Agent des Medienkapitals“ tätig?
Der Staat erbringt für das Kapital sowohl legitimatorische als auch geldwerte Leistungen:
a.) Zu den legitimatorischen Leistungen zählen:
o Die grundgesetzlich abgesicherten Garantien zur Wirtschafts- und Pressefreiheit, die Mediengesetze, die Sicherung der Eigentums- und Verwertungsrechte durch das Urheberrecht, die Absicherung der Produktionsverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit durch das Arbeits- und Tarifrecht, die Sicherung der Rahmenbedingungen für Werbung im Werberecht u.ä.
o Die Privatisierung, Deregulierung und Lizenzierung von privatwirtschaftlichen Medienunternehmen
o Die Garantie der Markt- und Wettbewerbsordnung sowie
o Die (ideologische) Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, wobei diese Leistungen sich indirekt auch ökonomisch positiv für die Kapitalakkumulation auswirken
b.) Der Staat erbringt für die Medienindustrie zusätzlich eine Vielzahl von geldwerten Leistungen, vor allem durch
o finanzielle Förderung der Medieninfrastruktur und der Technologieforschung, durch direkte und indirekte Subventionierung, im Rahmen der Standort- und Industriepolitik sowie
o durch umfangreiche öffentliche Anzeigen- und Werbeaufträge.
o Schließlich gibt der Staat auch über das Bildungssystem oder gesonderte Kampagnen Medienkonsumanreizen für die Bevölkerung.
- Zu beachten ist das besondere Interesse des Staates an einer für das Medienkapital optimalen Agentur-Leistung, da er nur dann die für ihn existenznotwendige Gegenleistung der medienvermittelten Sicherung der Massenloyalität für das herrschende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in der Bevölkerung erwarten kann.
19. Beschreiben und erläutern Sie Strategien von Innovation/Obsoleszenz für Produktions- und Konsumtionsmittel!
Innovations- und Obsoleszenzstrategien zur Erreichung für langlebige Kapitalakkumulation:
· geplante funktionell-technische Obsoleszenz als Funktionsveränderung, -erweiterung hinsichtlich des Grund und Zusatzgebrauchswerts eines Produkts
· geplante qualitiative Obsoleszenz als Gebrauchswertverschlechterung (früher Verschleiß, kurze Lebensdauer)
· geplante psychische/ästhetische Obsoleszenz – bewusstseinsmäßige Gebrauchswert-Entwertung (Unmodernmachen)
Ersatz von alter durch neue Technik durch Umwandlungsziele:
· langlebige Gebrauchswaren zu kurzlebigen Gebrauchswaren
· langlebige Gebrauchswaren zu kurzlebigen Verbrauchswaren
· Erweiterung der Produktion und Verkauf von kurzlebigen Verbrauchswaren (Wegwerfkamera…)
im Medienbereich häufig Obsoleszenz durch Systemvariationen
· zentrales Element wird verändert, dass gesamtes bisheriges System unbrauchbar wird
· für brauchbare Elemente wird Ersatz oder Zusatzkauf nötig
· alte Technik (obwohl noch bestens funktionierend) nicht mehr verwendbar
im Produktionsbereich
· dabei auch Wandlung der Produktionsweise nicht vergessen – Entwicklung und Anwendung von rentablen Informations-, Kommunikations-, Medientechniken wichtig (zb Integration von elektronischer Datenverarbeitung und Internet)
· neue Produktionsweise auf Basis von veränderten Produktionsmitteln und –verfahren dient Steigerung der Arbeitsproduktivität, Veränderung der Arbeitsverhältnisse
20. Was ist der Ausgangspunkt einer „Kritik der Politischen Ökonomie der Medien“? Warum erscheint dieser Ansatz als „unumgänglich“? Wie lässt sich die Notwendigkeit eines kapital- und kapitalismuszentrierten medienökonomischen Forschungsansatzes theoretisch und empirisch begründen?
· Medienproduktion wird in gesamtwirtschaftliches System kapitalistischer Waren- und Mehrwertproduktion einbezogen
· damit intensiv den „Bewegungsgesetzen“ und „Zwängen“, von Produktion und Kapitalverwertung, von Profitmaximierung und Konkurrenz, von Akkumulation und Konzentration unterworfen
· Gesamtgesellschaftlich: weitere, (als „Kommerzialisierung“ bezeichnete) Kapitalisierung von Information, Bildung, Politik, Kultur, Unterhaltung sowie von Arbeits- und Lebensverhältnissen
· daher Notwendigkeit eines kritischen kapital- bzw. kapitalismuszentrierten Ansatzes in der Kommunikationswissenschaft – durch grundsätzliche Bedeutung der fortschreitenden Kapitalisierung der Medienindustrie im engen Zusammenhang mit der Entwicklung des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems
· Gegenstandsbereich der Kritik der politischen Ökonomie ist die kritische theoriegeleitete empirische Kapitalismusanalyse.
· politische Ökonomie ist nicht Zweig der Wirtschaftswissenschaft, sondern umfassende Gesellschaftswissenschaft
· wichtig: Analyse und Kritik der „kapitalistischen Regulierung“ der Produktions- und Lebensverhältnisse, d.h. des gesamten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen menschlichen Lebens.
21. Welches sind die Ursachen für die Notwendigkeit und den Nutzen der Werbung für die Kapitalakkumulation?
Als Ursachen für die Notwendigkeit und den Nutzen der Werbung für die Kapitalakkumulation können folgende Phänomene identifiziert werden:
- Die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Tendenz zur notwendigen Steigerung der Arbeitsproduktivität erzeugt im Zusammenwirken mit den herrschenden Akkumulationsregimen und seiner Tendenz zu einer zwangsläufigen Überakkumulation einen erhöhten Verwertungs- bzw. Akkumulationszwang, der zu einem erhöhten Produktionszwang mit tendenziell zwangsläufiger Überproduktion führt, was über den Konkurrenzzwang den Verkaufszwang erhöht.
- Alles zusammen führt zu einem erhöhten Werbezwang, der als positiv zur Lösung der durch die vorgenannten Zwänge „selbst produzierten“ Kapitalverwertungsprobleme und der Bewältigung der generellen Krisenanfälligkeit der Kapitalakkumulation betrachtet und sichtbar mit großem Aufwand auch erfolgreich eingesetzt wird.
22. Was gehört zu den Grundfragen und zum Gegenstandsbereich einer Kritik der Politischen Ökonomie der Medien?
Der Gegenstandsbereich der Kritik der politischen Ökonomie ist die kritische theoriegeleitete empirische Kapitalismusanalyse. Es geht um die Analyse und Kritik der kapitalistischen Regulierung der Produktions- und Lebensverhältnisse. D.h. um den Bereich des gesamten wirtschaftlichen, gesellschaftlichem, sozialen, politischen und kulturellen menschlichen Lebens. Kapitalismus wird dabei als historische gewordene, grundsätzlich veränderbare Produktions- und Gesellschaftsform gesehen.
23. Was hat Karl Bücher zum „Wesen der Presse“ (Rolle des redaktionellen Teils im Verhältnis zum Anzeigenteil) gesagt? Welche Funktion hat er – neben der ökonomischen – n i c h t angesprochen?
• „...daß durch die ganze Presse hin die Zeitung jetzt den Charakter einer Unternehmung hat, welche Anzeigenraum als Ware produziert, die nur durch einen redaktionellen Teil absetzbar wird.“
• „Der redaktionelle Teil ist bloßes Mittel zum Zweck. Dieser besteht allein in dem Verkauf von Anzeigenraum; nur um für dieses Geschäft möglichst viele Abnehmer zu gewinnen, wendet der Verleger auch dem redaktionellen Teil seine Aufmerksamkeit zu und sucht durch Ausgaben für ihn seine Beliebtheit zu vergrößern. Denn je mehr Abonnenten, um so mehr Inserenten.
Sonst aber ist der redaktionelle Teil nur ein lästiges kostensteigerndes Element des Betriebes und wird nur deshalb mitgeführt, weil ohne ihn Abonnenten und in deren Gefolge Inserenten überhaupt nicht zu ha-ben wären.
'Öffentliche Interessen' werden in der Zeitung nur gepflegt, soweit es den Erwerbsabsichten des Verlegers nicht hinderlich ist.“
• „Der Unternehmer bezweckt nicht, wie naive Leute glauben, in ihr (der Zeitung) öffentliche Interessen zu vertreten und Kulturerrungen-schaften zu verbreiten, sondern aus dem Verkaufe von Anzeigenraum Gewinn zu ziehen. Der redaktionelle Inhalt der Zeitung ist für ihn bloß ein kostensteigerndes Mittel zu diesem Zweck, und es gehört zu den auffallendsten Erscheinungen der Kulturwelt, daß sie diesen Zustand noch immer erträgt.“
Was er z.B. nicht thematisiert ist die ganze politische Seite des Ganzen, also sprich der Funktion Herrschaftserhaltung. 1906 gab es noch keine ProNV oder Mediengesetze, also war der Staat noch recht frei im Umgang mit Zensur etc. Sprich damals haben die Medien bzw eher das Medium, wahrscheinlich noch mehr Einfluss gehabt auf die politischen Einstellungen der Menschen als heutzutage.
24. Kennzeichnen Sie das Verhältnis von Kapital und Arbeit!
Das Kapital ist stets auf der Seite der sogn. Arbeitgeber und steht in einem unverhältnismäßigem Zusammenhang mit Arbeit. Durch Ideologieproduktion werden die herrschenden Kapital- und Machtverhältnisse legitimiert.
Die Kapitallosen (eigentliche ArbeitsGEBER)verkaufen ihre Arbeitskraft an die Kapital- und Vermögenshalter (eigentliche ArbeitsNEHMER) zu einem ausgehandelten Betrag (Lohn/Gehalt). Sie stehen somit in direkter Abhängigkeit der Kapitalhalter. Durch die herrschende Ideologie wird diese Abhängigkeit als erstrebenswert dargstellt und somit die Machtverhältnisse gesichert. Ein weiteres Kennzeichen des Verhältnisses von Kapital und Arbeit ist die Tatsache, dass das Kapital stets an die Kapitalhalter zurück fließt. (Kauf von Waren im Handel [mit Gewinnaufschlag und Steuern])
Somit ist des den Abhängigen nicht/kaum möglich eigenes Kapital anzusammeln.
25. Welches sind die Funktionen bzw. Folgen erfolgreicher Werbung aus unternehmerischer Sicht?
„Prinzipiell muss man davon ausgehen, dass jede Art von Werbung in manipulatorischer Absicht geschieht. Kaum ein Unternehmen wird für seine Produkte werben in philanthropischer Ansicht, sondern doch wohl stets, um das Käuferverhalten zum eigenen Nutzen zu ändern. Das aber bedeutet Manipulation“ (Lay, 1980, S. 200)
Funktionen:
Werbung trägt zur Beschleunigung des Kapitalakkumulationsprozesses bei und darüber auch zur Festigung der allgemeinen Reproduktions- und Akkumulationsbedingungen (Kapitalverhältnis) des Kapitalismus. Weiters dient Werbung als unverzichtbares Gewinn-Realisierungs-Mittel. Eine weitere Funktion der Werbung liegt in der „Verhinderungs-Funktion“: Das vermeiden von Überproduktion, Überakkumulation und Kapitalverwertungsproblemen.
Folgen:
Die Kluft zwischen Arm und Reich, Mächtigen und Abhängigen, wird in gigantischem Ausmaß vergrößert. Sie trägt zur Stabilisierung der System-Grundlagen kapitalistischer Gesellschaften bei. Kapital-Arbeitsverhältnis, Akkumulationsregime, die ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen (Werbe-)Funktionen von Massenmedien.
also, paar fragen sind beantwortet, manche eben noch nicht. ;-)
vielleicht kann jemand die bestehenden lücken schließen, oder etwaige fehlerhaft beantwortete fragen richtig stellen - am besten über die kommentar funktion.
oder schreibt ein email an: guenter.baumgartner@sbg.ac.at - ich werd die antworten jeweils aktualisieren.
zum runterladen auf http://www.yahman.de!
danke für die zusammenarbeit.
grüße guda
----------------------------------------------------------------------------
1. Charakterisieren Sie die verschiedenen Kapital-Typen in der (erweiterten) Medienindustrie und deren Bedeutung für den Strukturwandel der Medienindustrie!
- Nach dem Kriterium des schwerpunktmäßigen Einsatzes der jeweiligen Kapitale in der Medienindustrie unterscheidet man 4 Kapital-Typen:
o Medienkapital: wird in der Produktion und Distribution der klassischen Mediensektoren verwertet (Presse, Buch, Hörfunk, Film, Fernsehen…)
o Medienbezogenes Kapital: Kapital für die technische Herstellung und Distribution von Medienproduktion sowie Produktion von Medientechnik (Papier-, Druck- und Maschinenbauindustrie, Post…)
o Medieninfrastrukturkapital: Kapital der Übertragungs- und Vermittlungstechnik und der Telekommunikationsdienste (Kabel-, Satelliten-, Telefonindustrie, Computerindustrie…)
o Medienfremdes Kapital: Kapital aus allen Wirtschaftszweigen (Banken, Handels-, Bau- und Verkehrsunternehmen)
- Kennzeichnend für den aktuellen Strukturwandel der Medienindustrie ist, es, dass nicht nur traditionelles Medienkapital, sondern auch zunehmend Kapital aus verschiedenen anderen Wirtschaftsbereichen aktiv ist, so dass man mit Recht von einer erweiterten Medienwirtschaft sprechen kann.
2. Welche Ebenen kann man bei der staatlichen Privatisierungspolitik allgemein unterscheiden? Inwiefern ist eine umfassende Privatisierungspolitik Kennzeichen eines grundlegenden Strukturwandels des Kapitalismus?
1.Drei Ebenen der staatlichen Privatisierung:
a) Staatskapitalprivatisierung = Überführung von Unternehmen, die bislang vollständig oder teilweise im Staatseigentum waren, in Privateigentum
b) Aufgabenprivatisierung = schrittweise Privatisierung öffentlicher Unternehmen aus dem Bereich der Infrastruktur, die bislang aufgrund der sozialen Bedeutung ihrer angebotenen öffentlichen Güter, als Träger öffentlicher Aufgaben fungierten.
c) Staatsprivatisierung = (Teil-)Privatisierung von klassischen Staatsfunktionen (z.B: privatwirtschaftliche Sicherheitsdienste, Universitäten) und Unterwerfung staatlicher Einrichtungen unter die Normen privatwirtschaftlicher Unternehmensprinzipien (öffentliche Verwaltungen, Universitäten).
2. Privatisierungspolitik als Kennzeichen für Strukturwandel des Kapitalismus:
Die Privatisierungspolitik des Staates ist ein Kennzeichen des Strukturwandels des Kapitalismus, da bislang, die vor allem in Westeuropa noch bestehenden mixed economics (= staatliches Eigentum an Produktionsmitteln als Korrektiv (= Mittel zum Ausgleich) zum privatwirtschaftlichen Eigentum an Produktionsmitteln) radikal in eine fast ausschließlich privatwirtschaftliche Ökonomie umgewandelt werden.
3. Welche Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie lassen sich benennen, die im Zusammenhang mit der „Entfesselung“ bzw. Transformation des Kapitalismus bzw. der Medienindustrie stehen?
- Die marktradikal „entfesselte“ Medienindustrie hängt mit dem ebenfalls „entfesselten“ globalen Transformationsprozess des Kapitalismus zusammen, der u.a. schlagwortartig als „Turbo Kapitalismus“ oder als „Shareholder-Society“ oder als „Kapitalismus pur“ gekennzeichnet wird.
- Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie sind folgende grundsätzliche für die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnende Faktoren:
o Das rechtlich geschützte Privateigentum an Produktionsmittel sowie die daraus abgeleitete Verfügungsmacht über die abhängig Arbeitenden sowie das Recht der alleinigen Bestimmung der Produktionsziele und der Verwertung der produzierten Waren durch das Kapital.
o Die Form kapitalistischer Produktionsverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse von Kapital über Arbeit
o Der widersprüchliche Zusammenhang von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
o Die kapitalistische Warenproduktion als Produktion von Werten (Gebrauchs- und Tauschwerte). Die Tauschwertrealisierung für die Kapitaleigner dominiert dabei die Gebrauchswertinteressen der Konsumenten.
o Die kapitalistische Mehrwertproduktion
o Der Zusammenhang von Produktions-, Verwertungs- und Profitzwang mit Konkurrenz, Akkumulation, Konzentration und Zentralisation des Kapitals
o Die kapitalistische Herrschaftssicherung durch das Zusammenwirken von Kapitaleignern und Staat
o Die Kapitalisierung der Gesellschaft
4. Welche „Ideologischen Mächte“ betreiben in welcher Weise die Ideologie- Produktion und -Distribution in der Gesellschaft? Welche Rolle spielen dabei die Massenmedien?
Die ideologischen Mächte sind/ ist der Staat (Regierung, Verwaltung, Polizei und Militär)
Sie betreiben ihre Ideologieproduktion und –distribution in dem sie ihre Vertreter (zB. Schulen, öffentlicher Dienst,…) mit Geld versorgen, denn damit müssen sich Vertreter nach den Interessen ihrer Kapitalgeber richten und orientieren. Diese Vertreter üben dann eine Art Zwang auf den einfachen Bürger aus, denn er will ja schließlich die „Produkte“ zB. Bildung, Sicherheit, Kleidung, Auto,… haben – weil ihm dies ja mittels der Massenmedien vermittelt wird, was man haben muss, braucht und so weiter also Ideologiedistribution wird mittels den Massenmedien betrieben.
5. Beschreiben und erläutern Sie verschiedene Formen von Kapitalisierungsschüben/Kapitalisierung der Medienindustrie!
Als Formen des Kapitalisierungsschubs in der Medienindustrie kann man folgende nennen:
o Produktversifikationen und –innovationen
o Die Privatisierung von Hörfunk, Fernsehen, Tele- und Mobilkommunikation sowie dem Internet
o Die Digitalisierung
o Neue Werbeformen /Merchandising
o Börsengänge und Kapitalbeschaffungen
o Aktiengesellschaft
Privatisierung: durch die Privatisierung kommt mehr Geld in die gesamte Medienindustrie
Kommerzialisierung: es werden zusätzliche Absatzmöglichkeiten geschaffen, es werden quasi neue Sachen geschaffen, die die Menschheit haben will
Erweiterung der Medienindustrie: durch zB. neue Werbeformen und Merchandising werden mehr Konsumenten erreicht bzw. man setzt mehr ab
Produktdiversifikation und –innovation: „alte Produkte“ werden variiert, verändert und als „neue Produkte“ auf den Markt gebracht. Es werden einfach mehr verschiedene Arten eines Produkts angeboten.
6. Beschreiben und erläutern Sie die hauptsächlichen Kapitalstrategien, die den Strukturwandel der Medienindustrie vorantreiben!
Vorrangig sind es 4 strategische Ziele:
>Ersatz von „alter“ durch „neue“ Medientechnik: von langfristigen Gebrauchsgütern zu kurzfristigen Verbrauchsgütern ( zb. Fernsehen – Schwarz-Weiß Fernseher, dann Farbfernseher, Stereofernsehgerät,…)
>Neue Übertragungswege für „alte“ Medienprodukte: also von analog auf digital (zb.: Modem – ISDN – DSL)
>Neue Eigentumsrechte für Mediensektoren und Netze
>Reduzierung von Produktions- und Transaktionskosten: geht in Richtung „Universalmedium“
7. Was bedeutet „Kapitalisierung“ der Medienindustrie? Welche wesentlichen Kennzeichen eines „Kapitalisierungsschubs“ in der Medienindustrie sind erkennbar?
- Darunter versteht man eine angesichts des unübersehbaren Strukturwandels einer durch Deregulierung, Privatisierung, Digitalisierung, Konzentration, Globalisierung etc. „entfesselte Medienindustrie“. Es geht also um eine weitere historische Phase der fortschreitenden Kapitalisierung der privatwirtschaftlichen Medienindustrie, d.h. um eine radikale Unterordnung des gesamten Mediensystems unter die allgemeinen Kapitalverwertungsbedingungen. Die Medienindustrie ist damit auch intensiver als bisher den Bewegungsgesetzen und Zwängen von Produktion und Kapitalverwertung, von Profitmaximierung und Konkurrenz sowie von Akkumulation und Konzentration unterworfen.
- Kennzeichen des Kapitalisierungsschubs in der Medienindustrie sind:
o Eine Kapitalisierung über Privatisierung, Deregulierung, Kommerzialisierung von zusätzlichen Sektoren der Medienindustrie, die bislang staatlich oder ö.r. waren
o Ein Strukturwandel, der sich in Kommerzialisierung der Medieninhalte-Produktion, in internationaler publizistischer und ökonomischer Konzentration und in Verflechtungen traditioneller und neuer Sektoren zeigt
o Kapitalisierung des Verhältnisses von Staat und Medienwirtschaft, sowie der staatlichen Medienpolitik als Medienwirtschaftspolitik
o Kapitalisierung der ökonomischen und politischen Funktionserfüllung der Medienindustrie)
8. Wie ist Ideologie im Rahmen von wissenschaftlicher Ideologiekritik definiert? Was impliziert diese Definition und was n i c h t ? Welcher Zusammenhang besteht mit Herrschaft und wie ist diese definiert?
Definition von Ideologie:
Gedankliches/emotionales Gerüst und praktisch wirksames Konstrukt von Sinnstiftung, Normsetzung und Legitimation/Verschleierung von Herrschaft
- zur Stabilisierung und Reproduktion von Herrschaft
- komplementär zu repressiven Mitteln der zwangsweisen Durchsetzung von Herrschaft
diese impliziert…
- Trennung von Wissenschaft und Ideologie
- Wahrheit/Wirklichkeit vs. Ideologie
Diese impliziert nicht…
- Ideologie im Sinne von „Weltanschauung“
- Im Sinne eines „wissenschaftlichen Marxismus als Ideologie“
- Im Sinne der Wissenssoziologie als „geistige Gebilde“
Zusammenhang mit Herrschaft:
- zwangsweise Durchsetzung von Herrschaft durch Ideologieproduktion
- Stabilisierung und Reproduktion von Herrschaft
Herrschaft:
- umfassende ökonomische/politische/kulturelle/gesellschaftliche Verfügungsmacht
- einer gesellschaftlichen Klasse/Schicht/Gruppe
- über eine oder mehrere andere Klasse(n)/Schicht(en)/Gruppe(n) (Arbeits- und Lebensverhältnisse)
9. Worin zeigte sich in der Geschichte der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft eine „Angst vor Marx“ und eine „Angst, als Marxist zu gelten“? Wie berechtigt ist die eine und die andere Angst?
- Die Analysen von Karl Marx werden in der Regel verschwiegen oder marginalisiert, wenn sie thematisiert werden, so am ehesten negativ. Es kam zur weltweit eindeutigen Dominanz der neuklassischen Sicht. Wer Marx’sche Theorien adaptierte, wurde als (gefährlicher) Marxist, Kommunist, Systemgegner… abgestempelt und in seinen Möglichkeiten der Berufstätigkeit in Wissenschaft, Massenmedien usw. erheblich Berufsverbote).
- Daher unberechtigte Angst vor Marx, aber berechtigte Angst als Marxist zu gelten
10. Welche Stadien der Entwicklung von staatlicher De- und Re- Regulierungspolitik und „Selbstregulierung“ des Kapitals lassen sich im Strukturwandel der Medienindustrie erkennen? Welches Stadium ist das dominante?
- 3 sich zeitlich überlappende Stadien der Entwicklung:
o Deregulierung von Seiten des Staates durch Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen für die Privatisierung staatlicher oder ö.r. Unternehmen
o Selbstregulierung der Industrien hauptsächlich durch Großkapitale mit Hilfe eines wettbewerbsbeschränkenden Marktverhaltens mit dem Ziel der Marktbeherrschung.
o (Re-)Regulierung von Seiten des Staates, ebenfalls durch Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen, mit dem Ziel, die Verwertungsbedingungen des marktbeherrschenden Kapitals durch eine „Marktordnung“ und gezielte Förderungsmaßnahmen risikomindernd mittel- bis langfristig abzusichern und „Legitimierungen“ zu schaffen.
11. Benennen Sie verschiedene Folgen der Kapitalisierung der Medienindustrie, die bedeutsam sind!
- Als allgemeinste Folge der weiteren Kapitalisierung der Medienindustrie ist zu beobachten, dass die Medienindustrie noch stärker als bisher dem allgemeinen und medienspezifischen Struktur- und Funktionswandel von Wirtschaft und Gesellschaft gemäß den Kapitalverwertungsinteressen unterzogen wird und diesen gleichzeitig mit beeinflusst. Die Folgen der damit einhergehenden Ausweitung der Kommerzialisierung der Medienproduktion erstrecken sich insbesondere auf:
o Die Gestaltung der Medienprodukte als Konsumgüter
o Den Ausbau der Funktion der Medien als Werbe- bzw. Warenzirkulationsmittel für die Volkswirtschaft
o Die Verstärkung internationaler Kapital- und Marktkonzentration
o Die Ausbreitung struktureller Arbeitslosigkeit in der Medienindustrie
o Die Regeneration der Arbeitskräfte gemäß Kapitalinteressen
o Die Beeinflussung der Bevölkerung im Hinblick auf Absatzförderung
o Die weitere Ausrichtung staatlicher Medienpolitik an den Kapitalinteressen
o Die Legitimation und Herrschaftssicherung des internationalen kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems
12. Beschreiben Sie Ansätze zu ökonomischen Regulierungstheorien mit
ihrer jeweiligen Sichtweise der Rolle des Staates gegenüber dem Kapital!
- In der Sichtweise der normativen neoklassischen bzw. neoliberalen Theorie, in der Regulierung als systemwidriger Staatseingriff in die individuelle Handlungsfreiheit des Kapitals grundsätzlich als negativ und nur im Ausnahmefall des Marktversagens als notwendig angesehen wird, soll sich der Staat mit Regulierungsmaßnahmen zurückhalten.
- In der einfachen Capture-Theorie der Chicagoer Schule wird staatliche Regulierung als „ein Mittel zur Durchsetzung der Interessen der Regulierten“ angesehen.
- In der erweiterten Capture-Theorie werden vom Staat als Regulator auch Konsumenteninteressen berücksichtigt, soweit es als politisch angebracht erscheint.
- In der Sichtweise des Neuen Institutionalismus in Verbindungen mit dem Transaktionskostenansatz geht man davon aus, dass Regulierung durchaus kostengünstig und effizient und deshalb für das Kapital nützlich bis notwendig sein können; Regulierungen sind jedoch nicht auf staatliche Aktivitäten beschränkt, sondern auch über Verträge zwischen Firmen möglich.
- In der Keynesianischen Theorie wird staatliche Regulierung grundsätzlich als notwendig angesehen, um langfristig sinnvolles Investitionsverhalten von Unternehmen zu ermöglichen und damit die Stabilität der gesamten Wirtschaft zu sichern.
- In der marxistischen Theorie des Staatsmonopolistischen Kapitalismus gilt die staatliche Regulierung im Interesse und im Zusammenwirken mit privatwirtschaftlichen Monopolen als ein wesentliches Strukturmerkmal des kapitalistischen Wirtschaftssystems und damit als eine notwendige zentrale Steuerungsinstanz
- In der (französischen) Regulationstheorie, die beansprucht, mehr als eine nur ökonomische Theorie zur Funktionsweise des Kapitalismus zu sein, wird dem Staat ein zentraler Stellenwert im System verschiedener regulativer Institutionen zugeschrieben. Allerdings wird von Kritikern eingewandt, dass es an einer näheren Bestimmung der Rolle des Staates bislang mangele.
13. Beschreiben und erläutern Sie Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie!
Ursachen der Kapitalisierung der Medienindustrie sind folgende grundsätzliche für die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnende Faktoren:
o Das rechtlich geschützte Privateigentum an Produktionsmittel sowie die daraus abgeleitete Verfügungsmacht über die abhängig Arbeitenden sowie das Recht der alleinigen Bestimmung der Produktionsziele und der Verwertung der produzierten Waren durch das Kapital.
o Die Form kapitalistischer Produktionsverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse von Kapital über Arbeit
o Der widersprüchliche Zusammenhang von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
o Die kapitalistische Warenproduktion als Produktion von Werten (Gebrauchs- und Tauschwerte). Die Tauschwertrealisierung für die Kapitaleigner dominiert dabei die Gebrauchswertinteressen der Konsumenten.
o Die kapitalistische Mehrwertproduktion
o Der Zusammenhang von Produktions-, Verwertungs- und Profitzwang mit Konkurrenz, Akkumulation, Konzentration und Zentralisation des Kapitals
o Die kapitalistische Herrschaftssicherung durch das Zusammenwirken von Kapitaleignern und Staat
o Die Kapitalisierung der Gesellschaft
14. Wie wahrscheinlich ist eine „Universalisierung“ des Mediensystems? Welche unterschiedlichen Interessenlagen sind voraussichtlich in welchem Ausmaß bestimmend dafür, wie die bestehenden Separierungen von Medienproduktion, -distribution und -konsumtion in Richtung (partieller) „Universalisierung“ verändert werden?
- Traditionelle Produktion, Distribution und Konsumtion von Medien vs. Universalmedium:
o Produktion: Wegfall von Unternehmensbereichen für Produktion von begrenzten Kommunikationsformen, wie nur Text-/Bildkommunikation (Presse- und Buchverlag) oder nur Tonkommunikation (Musikverlage)
o Speicherung/Reproduktion: Wegfall von Unternehmensbereichen für die Herstellung jeglicher Trägemedien
o Distribution/Übertragung: Wegfall von Unternehmensbereichen für den Vertrieb weiterer Trägermedien und die Herstellung von gesonderten Netzen.
o Konsumption: Wegfall von Unternehmen für die Herstellung von gesonderten Empfangsgeräten für Ton- und AV-Medien.
Marktbeherrschenden Medienunternehmen, die Ausmaß, Reihenfolge und Tempo der Universalisierung bestimmen und potentielle Nutznießer einer Universalisierung wären, sind nur teilweise daran interessiert, da ihnen zum einen eine komplementäre Produktion, Distribution und Konsumtion mehr dient als eine substitutive und zum anderen in diesem Fall die Mehrfachverwertung wegfallen würde, die für die Kapitalverwertung existenznotwendig ist. D.h. eine Separierung in verschiedene Mediensektoren und Übertragungswege ist derzeit noch ökonomisch gewollt und genutzt.
15. Was bedeutet „Kapitalisierung“ der Medienindustrie? Welche wesentlichen Kennzeichen eines „Kapitalisierungsschubs“ in der Medienindustrie sind erkennbar?
- Darunter versteht man eine angesichts des unübersehbaren Strukturwandels einer durch Deregulierung, Privatisierung, Digitalisierung, Konzentration, Globalisierung etc. „entfesselte Medienindustrie“. Es geht also um eine weitere historische Phase der fortschreitenden Kapitalisierung der privatwirtschaftlichen Medienindustrie, d.h. um eine radikale Unterordnung des gesamten Mediensystems unter die allgemeinen Kapitalverwertungsbedingungen. Die Medienindustrie ist damit auch intensiver als bisher den Bewegungsgesetzen und Zwängen von Produktion und Kapitalverwertung, von Profitmaximierung und Konkurrenz sowie von Akkumulation und Konzentration unterworfen.
- Kennzeichen des Kapitalisierungsschubs in der Medienindustrie sind:
o Eine Kapitalisierung über Privatisierung, Deregulierung, Kommerzialisierung von zusätzlichen Sektoren der Medienindustrie, die bislang staatlich oder ö.r. waren
o Ein Strukturwandel, der sich in Kommerzialisierung der Medieninhalte-Produktion, in internationaler publizistischer und ökonomischer Konzentration und in Verflechtungen traditioneller und neuer Sektoren zeigt
o Kapitalisierung des Verhältnisses von Staat und Medienwirtschaft, sowie der staatlichen Medienpolitik als Medienwirtschaftspolitik
o Kapitalisierung der ökonomischen und politischen Funktionserfüllung der Medienindustrie)
16. Beschreiben und erläutern Sie die „Kettenreaktionen“ von Investition und Produkt-„Innovation“ im Kapitalakkumulationsprozess!
Es besteht ein Zusammenhang von Medientechniken mit Investitions-, Produktions-, Distributions-, und Konsumtionsmitteln. Daraus ergeben sich Investitions-/ Produktions- und Innovations- Zwänge. Diese lösen bestimmte Kettenreaktionen von Investition und Produkt- Innovation im Kapitalakkumulationsprozess aus.
Treibende Kräfte:
- das durch Profitmaximierung angehäufte Kapital, dessen Entwertung durch Überakkumulation, Überkapazität und Überproduktion droht
- Gefahr der gesättigten Märkte
Im Zusammenhang damit spielt die Entwicklung und der Einsatz alter und neuer Medientechniken eine zentrale Rolle.
Der Ersatz von alter durch neue Medientechnik dient drei Zielen:
- langlebige Gebrauchswaren zu möglichst kurzlebigen Gebrauchswaren
- langlebige Gebrauchswaren zu möglichst kurzlebigen Verbrauchwaren
- Erweiterung der Produktion und des Verkaufs von kurzlebigen Verbrauchswaren (z.B.: Wegwerfkamera).
Innovations- /Obsoleszenz (= Abnutzung) – Strategien:
- geplante funktionell- technische O. als reale Funktionsveränderung /-erweiterung hinsichtlich des Zusatzgebrauchwert eines Produkts
- geplante qualitative O. als reale Gebrauchswertverschlechterung (frühzeitiger Verschleiß)
- geplante psychische/ ästhetische O. als ästhetische Innovation/Veralterung als bewusstseinsmässige Gebrauchswertentwertung (unmodern machen)
17. Welche ökonomischen und gesellschaftlichen Funktionen der Medienproduktion stehen im Mittelpunkt einer Kritik der politischen Ökonomie der Medien?
- Grundlegend sind vier Hauptfunktionen der Medienproduktion, 2 ökonomische und 2 gesellschaftliche:
o Kapitalverwertungsfunktion: Medienprodukte werden als Waren mit Gebrauchswert produziert, um einen Tauschwert zu ermöglichen, welcher den Medien-Kapitaleignern einen Mehrwert bringt
o Absatzförderungsfunktion: Medienprodukte müssen einen Gebrauchswert haben, um einen Tauschwert für Konsumgüter als Waren zu fördern
o Funktion der Legitimations- und Herrschaftssicherung: Medienkapital erfüllt systemsichernde Gattungsgeschäfte
o Funktionen der Regeneration, Qualifizierung und „Reparatur“ des Arbeitsvermögens: Mittels der Medienprodukte wird im Interesse der Kapitaleigner und des mit ihnen eng kooperierenden Staates ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Reproduktion der Arbeitskräfte geleistet
18. Nennen Sie einige legitimatorische und geldwerte Leistungen des Staates für das Medienkapital! Inwiefern ist hierbei der Staat als „Agent des Medienkapitals“ tätig?
Der Staat erbringt für das Kapital sowohl legitimatorische als auch geldwerte Leistungen:
a.) Zu den legitimatorischen Leistungen zählen:
o Die grundgesetzlich abgesicherten Garantien zur Wirtschafts- und Pressefreiheit, die Mediengesetze, die Sicherung der Eigentums- und Verwertungsrechte durch das Urheberrecht, die Absicherung der Produktionsverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit durch das Arbeits- und Tarifrecht, die Sicherung der Rahmenbedingungen für Werbung im Werberecht u.ä.
o Die Privatisierung, Deregulierung und Lizenzierung von privatwirtschaftlichen Medienunternehmen
o Die Garantie der Markt- und Wettbewerbsordnung sowie
o Die (ideologische) Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, wobei diese Leistungen sich indirekt auch ökonomisch positiv für die Kapitalakkumulation auswirken
b.) Der Staat erbringt für die Medienindustrie zusätzlich eine Vielzahl von geldwerten Leistungen, vor allem durch
o finanzielle Förderung der Medieninfrastruktur und der Technologieforschung, durch direkte und indirekte Subventionierung, im Rahmen der Standort- und Industriepolitik sowie
o durch umfangreiche öffentliche Anzeigen- und Werbeaufträge.
o Schließlich gibt der Staat auch über das Bildungssystem oder gesonderte Kampagnen Medienkonsumanreizen für die Bevölkerung.
- Zu beachten ist das besondere Interesse des Staates an einer für das Medienkapital optimalen Agentur-Leistung, da er nur dann die für ihn existenznotwendige Gegenleistung der medienvermittelten Sicherung der Massenloyalität für das herrschende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in der Bevölkerung erwarten kann.
19. Beschreiben und erläutern Sie Strategien von Innovation/Obsoleszenz für Produktions- und Konsumtionsmittel!
Innovations- und Obsoleszenzstrategien zur Erreichung für langlebige Kapitalakkumulation:
· geplante funktionell-technische Obsoleszenz als Funktionsveränderung, -erweiterung hinsichtlich des Grund und Zusatzgebrauchswerts eines Produkts
· geplante qualitiative Obsoleszenz als Gebrauchswertverschlechterung (früher Verschleiß, kurze Lebensdauer)
· geplante psychische/ästhetische Obsoleszenz – bewusstseinsmäßige Gebrauchswert-Entwertung (Unmodernmachen)
Ersatz von alter durch neue Technik durch Umwandlungsziele:
· langlebige Gebrauchswaren zu kurzlebigen Gebrauchswaren
· langlebige Gebrauchswaren zu kurzlebigen Verbrauchswaren
· Erweiterung der Produktion und Verkauf von kurzlebigen Verbrauchswaren (Wegwerfkamera…)
im Medienbereich häufig Obsoleszenz durch Systemvariationen
· zentrales Element wird verändert, dass gesamtes bisheriges System unbrauchbar wird
· für brauchbare Elemente wird Ersatz oder Zusatzkauf nötig
· alte Technik (obwohl noch bestens funktionierend) nicht mehr verwendbar
im Produktionsbereich
· dabei auch Wandlung der Produktionsweise nicht vergessen – Entwicklung und Anwendung von rentablen Informations-, Kommunikations-, Medientechniken wichtig (zb Integration von elektronischer Datenverarbeitung und Internet)
· neue Produktionsweise auf Basis von veränderten Produktionsmitteln und –verfahren dient Steigerung der Arbeitsproduktivität, Veränderung der Arbeitsverhältnisse
20. Was ist der Ausgangspunkt einer „Kritik der Politischen Ökonomie der Medien“? Warum erscheint dieser Ansatz als „unumgänglich“? Wie lässt sich die Notwendigkeit eines kapital- und kapitalismuszentrierten medienökonomischen Forschungsansatzes theoretisch und empirisch begründen?
· Medienproduktion wird in gesamtwirtschaftliches System kapitalistischer Waren- und Mehrwertproduktion einbezogen
· damit intensiv den „Bewegungsgesetzen“ und „Zwängen“, von Produktion und Kapitalverwertung, von Profitmaximierung und Konkurrenz, von Akkumulation und Konzentration unterworfen
· Gesamtgesellschaftlich: weitere, (als „Kommerzialisierung“ bezeichnete) Kapitalisierung von Information, Bildung, Politik, Kultur, Unterhaltung sowie von Arbeits- und Lebensverhältnissen
· daher Notwendigkeit eines kritischen kapital- bzw. kapitalismuszentrierten Ansatzes in der Kommunikationswissenschaft – durch grundsätzliche Bedeutung der fortschreitenden Kapitalisierung der Medienindustrie im engen Zusammenhang mit der Entwicklung des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems
· Gegenstandsbereich der Kritik der politischen Ökonomie ist die kritische theoriegeleitete empirische Kapitalismusanalyse.
· politische Ökonomie ist nicht Zweig der Wirtschaftswissenschaft, sondern umfassende Gesellschaftswissenschaft
· wichtig: Analyse und Kritik der „kapitalistischen Regulierung“ der Produktions- und Lebensverhältnisse, d.h. des gesamten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen menschlichen Lebens.
21. Welches sind die Ursachen für die Notwendigkeit und den Nutzen der Werbung für die Kapitalakkumulation?
Als Ursachen für die Notwendigkeit und den Nutzen der Werbung für die Kapitalakkumulation können folgende Phänomene identifiziert werden:
- Die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Tendenz zur notwendigen Steigerung der Arbeitsproduktivität erzeugt im Zusammenwirken mit den herrschenden Akkumulationsregimen und seiner Tendenz zu einer zwangsläufigen Überakkumulation einen erhöhten Verwertungs- bzw. Akkumulationszwang, der zu einem erhöhten Produktionszwang mit tendenziell zwangsläufiger Überproduktion führt, was über den Konkurrenzzwang den Verkaufszwang erhöht.
- Alles zusammen führt zu einem erhöhten Werbezwang, der als positiv zur Lösung der durch die vorgenannten Zwänge „selbst produzierten“ Kapitalverwertungsprobleme und der Bewältigung der generellen Krisenanfälligkeit der Kapitalakkumulation betrachtet und sichtbar mit großem Aufwand auch erfolgreich eingesetzt wird.
22. Was gehört zu den Grundfragen und zum Gegenstandsbereich einer Kritik der Politischen Ökonomie der Medien?
Der Gegenstandsbereich der Kritik der politischen Ökonomie ist die kritische theoriegeleitete empirische Kapitalismusanalyse. Es geht um die Analyse und Kritik der kapitalistischen Regulierung der Produktions- und Lebensverhältnisse. D.h. um den Bereich des gesamten wirtschaftlichen, gesellschaftlichem, sozialen, politischen und kulturellen menschlichen Lebens. Kapitalismus wird dabei als historische gewordene, grundsätzlich veränderbare Produktions- und Gesellschaftsform gesehen.
23. Was hat Karl Bücher zum „Wesen der Presse“ (Rolle des redaktionellen Teils im Verhältnis zum Anzeigenteil) gesagt? Welche Funktion hat er – neben der ökonomischen – n i c h t angesprochen?
• „...daß durch die ganze Presse hin die Zeitung jetzt den Charakter einer Unternehmung hat, welche Anzeigenraum als Ware produziert, die nur durch einen redaktionellen Teil absetzbar wird.“
• „Der redaktionelle Teil ist bloßes Mittel zum Zweck. Dieser besteht allein in dem Verkauf von Anzeigenraum; nur um für dieses Geschäft möglichst viele Abnehmer zu gewinnen, wendet der Verleger auch dem redaktionellen Teil seine Aufmerksamkeit zu und sucht durch Ausgaben für ihn seine Beliebtheit zu vergrößern. Denn je mehr Abonnenten, um so mehr Inserenten.
Sonst aber ist der redaktionelle Teil nur ein lästiges kostensteigerndes Element des Betriebes und wird nur deshalb mitgeführt, weil ohne ihn Abonnenten und in deren Gefolge Inserenten überhaupt nicht zu ha-ben wären.
'Öffentliche Interessen' werden in der Zeitung nur gepflegt, soweit es den Erwerbsabsichten des Verlegers nicht hinderlich ist.“
• „Der Unternehmer bezweckt nicht, wie naive Leute glauben, in ihr (der Zeitung) öffentliche Interessen zu vertreten und Kulturerrungen-schaften zu verbreiten, sondern aus dem Verkaufe von Anzeigenraum Gewinn zu ziehen. Der redaktionelle Inhalt der Zeitung ist für ihn bloß ein kostensteigerndes Mittel zu diesem Zweck, und es gehört zu den auffallendsten Erscheinungen der Kulturwelt, daß sie diesen Zustand noch immer erträgt.“
Was er z.B. nicht thematisiert ist die ganze politische Seite des Ganzen, also sprich der Funktion Herrschaftserhaltung. 1906 gab es noch keine ProNV oder Mediengesetze, also war der Staat noch recht frei im Umgang mit Zensur etc. Sprich damals haben die Medien bzw eher das Medium, wahrscheinlich noch mehr Einfluss gehabt auf die politischen Einstellungen der Menschen als heutzutage.
24. Kennzeichnen Sie das Verhältnis von Kapital und Arbeit!
Das Kapital ist stets auf der Seite der sogn. Arbeitgeber und steht in einem unverhältnismäßigem Zusammenhang mit Arbeit. Durch Ideologieproduktion werden die herrschenden Kapital- und Machtverhältnisse legitimiert.
Die Kapitallosen (eigentliche ArbeitsGEBER)verkaufen ihre Arbeitskraft an die Kapital- und Vermögenshalter (eigentliche ArbeitsNEHMER) zu einem ausgehandelten Betrag (Lohn/Gehalt). Sie stehen somit in direkter Abhängigkeit der Kapitalhalter. Durch die herrschende Ideologie wird diese Abhängigkeit als erstrebenswert dargstellt und somit die Machtverhältnisse gesichert. Ein weiteres Kennzeichen des Verhältnisses von Kapital und Arbeit ist die Tatsache, dass das Kapital stets an die Kapitalhalter zurück fließt. (Kauf von Waren im Handel [mit Gewinnaufschlag und Steuern])
Somit ist des den Abhängigen nicht/kaum möglich eigenes Kapital anzusammeln.
25. Welches sind die Funktionen bzw. Folgen erfolgreicher Werbung aus unternehmerischer Sicht?
„Prinzipiell muss man davon ausgehen, dass jede Art von Werbung in manipulatorischer Absicht geschieht. Kaum ein Unternehmen wird für seine Produkte werben in philanthropischer Ansicht, sondern doch wohl stets, um das Käuferverhalten zum eigenen Nutzen zu ändern. Das aber bedeutet Manipulation“ (Lay, 1980, S. 200)
Funktionen:
Werbung trägt zur Beschleunigung des Kapitalakkumulationsprozesses bei und darüber auch zur Festigung der allgemeinen Reproduktions- und Akkumulationsbedingungen (Kapitalverhältnis) des Kapitalismus. Weiters dient Werbung als unverzichtbares Gewinn-Realisierungs-Mittel. Eine weitere Funktion der Werbung liegt in der „Verhinderungs-Funktion“: Das vermeiden von Überproduktion, Überakkumulation und Kapitalverwertungsproblemen.
Folgen:
Die Kluft zwischen Arm und Reich, Mächtigen und Abhängigen, wird in gigantischem Ausmaß vergrößert. Sie trägt zur Stabilisierung der System-Grundlagen kapitalistischer Gesellschaften bei. Kapital-Arbeitsverhältnis, Akkumulationsregime, die ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen (Werbe-)Funktionen von Massenmedien.
guda - 21:01

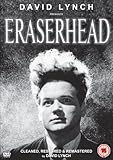

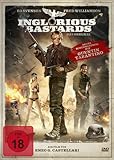
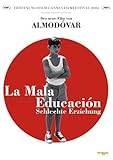
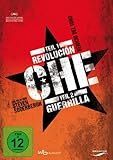
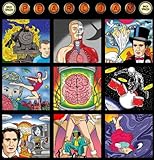






Welche Ebenen kann man bei der staatlichen Privatisierungspolitik allgemein unterscheiden? Inwiefern ist eine umfassende Privatisierungspolitik Kennzeichen eines grundlegenden Strukturwandels des Kapitalismus?
1.Drei Ebenen der staatlichen Privatisierung:
a) Staatskapitalprivatisierung = Überführung von Unternehmen, die bislang vollständig oder teilweise im Staatseigentum waren, in Privateigentum
b) Aufgabenprivatisierung = schrittweise Privatisierung öffentlicher Unternehmen aus dem Bereich der Infrastruktur, die bislang aufgrund der sozialen Bedeutung ihrer angebotenen öffentlichen Güter, als Träger öffentlicher Aufgaben fungierten.
c) Staatsprivatisierung = (Teil-)Privatisierung von klassischen Staatsfunktionen (z.B: privatwirtschaftliche Sicherheitsdienste, Universitäten) und Unterwerfung staatlicher Einrichtungen unter die Normen privatwirtschaftlicher Unternehmensprinzipien (öffentliche Verwaltungen, Universitäten).
2. Privatisierungspolitik als Kennzeichen für Strukturwandel des Kapitalismus:
Die Privatisierungspolitik des Staates ist ein Kennzeichen des Strukturwandels des Kapitalismus, da bislang, die vor allem in Westeuropa noch bestehenden mixed economics (= staatliches Eigentum an Produktionsmitteln als Korrektiv (= Mittel zum Ausgleich) zum privatwirtschaftlichen Eigentum an Produktionsmitteln) radikal in eine fast ausschließlich privatwirtschaftliche Ökonomie umgewandelt werden.
Frage 16)
Beschreiben und erläutern Sie die ‚Kettenreaktionen’ von Investition und Produkt-‚Innovation’ im Kapitalakkumulationsprozess!
Es besteht ein Zusammenhang von Medientechniken mit Investitions-, Produktions-, Distributions-, und Konsumtionsmitteln. Daraus ergeben sich Investitions-/ Produktions- und Innovations- Zwänge. Diese lösen bestimmte Kettenreaktionen von Investition und Produkt- Innovation im Kapitalakkumulationsprozess aus.
Treibende Kräfte:
- das durch Profitmaximierung angehäufte Kapital, dessen Entwertung durch Überakkumulation, Überkapazität und Überproduktion droht
- Gefahr der gesättigten Märkte
Im Zusammenhang damit spielt die Entwicklung und der Einsatz alter und neuer Medientechniken eine zentrale Rolle.
Der Ersatz von alter durch neue Medientechnik dient drei Zielen:
- langlebige Gebrauchswaren zu möglichst kurzlebigen Gebrauchswaren
- langlebige Gebrauchswaren zu möglichst kurzlebigen Verbrauchwaren
- Erweiterung der Produktion und des Verkaufs von kurzlebigen Verbrauchswaren (z.B.: Wegwerfkamera).
Innovations- /Obsoleszenz (= Abnutzung) – Strategien:
- geplante funktionell- technische O. als reale Funktionsveränderung /-erweiterung hinsichtlich des Zusatzgebrauchwert eines Produkts
- geplante qualitative O. als reale Gebrauchswertverschlechterung (frühzeitiger Verschleiß)
- geplante psychische/ ästhetische O. als ästhetische Innovation/Veralterung als bewusstseinsmässige Gebrauchswertentwertung (unmodern machen)
(siehe: Entwicklung von Medientechniken im Kapitalinteresse S.52)
Frage 19
Beschreiben und erläutern Sie Strategien von Innovation/Obsoleszenz für Produktions- und Konsumtionsmittel!
• 3 Strategien → eingesetzt zur Erreichung der „Umwandlungs“- Ziele
= Ersatz von „alter“ durch „neue“ Medientechnik → existenznotwendig für die Kapitalakkumulation
(= Kapitalanhäufung)
1. Funktionell-technische Innovation/Obsoleszenz (= lat. Abnützung, Veraltung)
= reale Funktionsveränderung/ -erweiterung
→ des Grund- und/oder Zusatz- Gebrauchswertes eines Produkts
2. Qualitative Innovation/Obsoleszens
= reale Gebrauchswert- Verschlechterung
z.B. → „eingebauter“ frühzeitiger Verschleiß
Verkürzung der physischen/wirtschaftlichen Lebensdauer von Produkten
Unterlassung von möglichen Qualitäts- und Haltbarkeitsverbesserungen
3. Psychische/ ästhetische Innovation/Obsoleszenz
= bewusstseinsmäßige Gebrauchsentwertung → ästhetische Innovation/ Veralterung
→ „Warenästhetik“
(„Unmodernmachen“ eines noch im Gebrauch befindlichen/ grundsätzlich brauchbaren Langlebigen Produkts)
• Strategien = kapitalistische Gesetzmäßigkeiten
→ Verkürzung der Lebensdauer von Produkten
→ beschleunigter Modewechsel
→ in der Regel in Kombination miteinander angewandt
Bsp.: Produktsystem mit mehreren Produktelementen (z.B. Kamera, Film, Projektor, Zubehör)
→ ein zentrales Element wird so verändert, dass das gesamte bisherige System unbrauchbar wird (z.B. Einstellung der Produktion bestimmter Ersatzteile) unbrauchbar erscheint (z.B. unmodernes Design, schlechtere Qualität)
• Erfolg derartiger Strategien
→ konkrete produktbezogene Werbe- und Marketingmaßnahmen
→ vielfältige allumfassense Stimulierungen (per Werbung, Marketing, PR, Kunst…)
eines gesellschaftlichen Umwetungsprozesses von Werten
(z.B. Geringschätzung des „Altem ↔ Hochschätzung des „Neuem“; Überwindung von Sparsamkeit…)